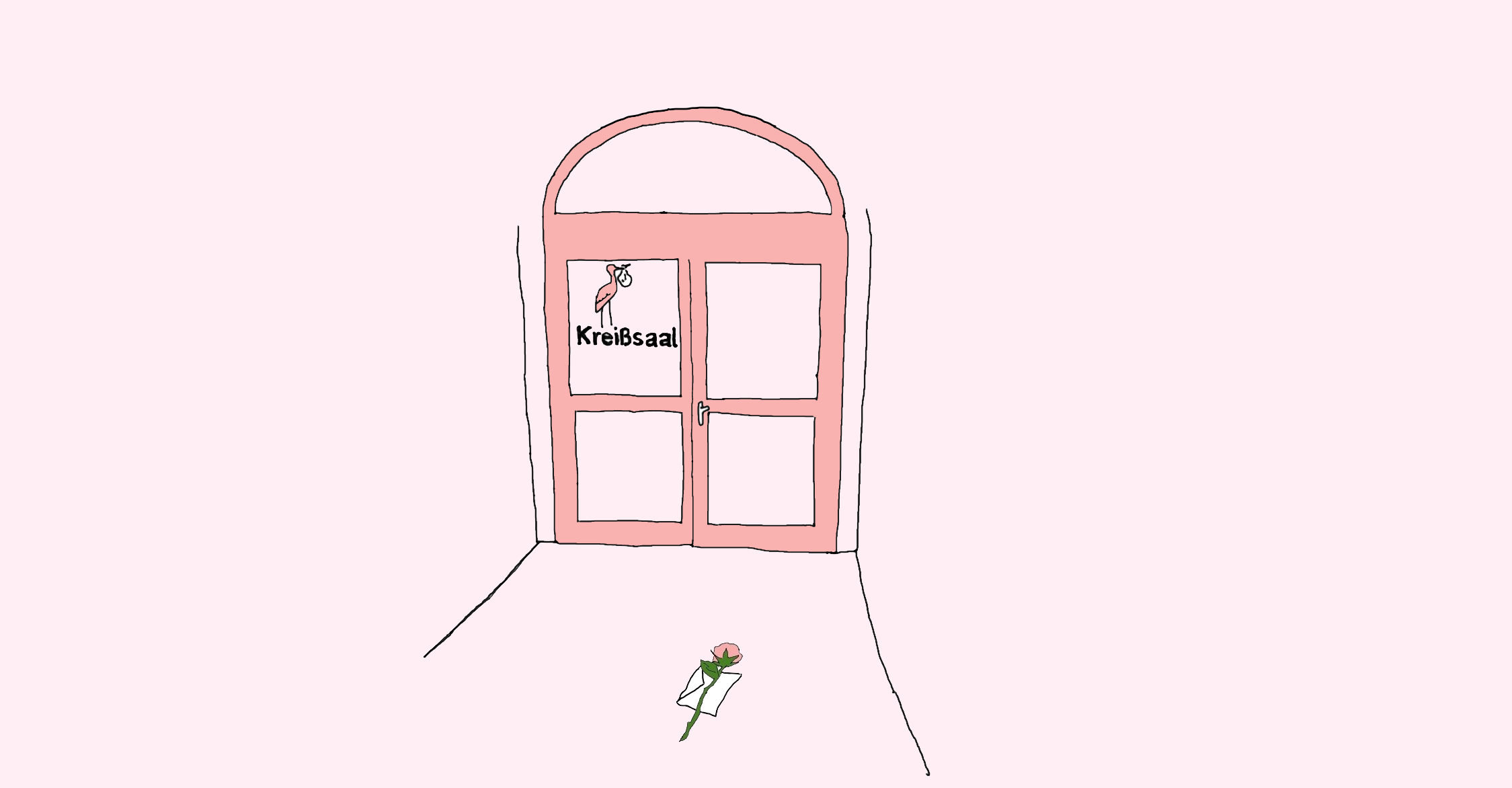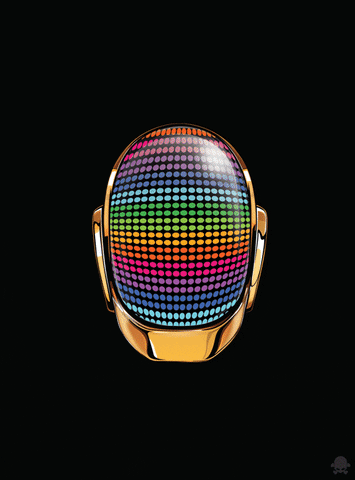Wir treffen uns am Ostkreuz, haben uns seit Jahren nicht mehr gesehen, und die Wohnsituation in Berlin führt uns wieder zusammen. Wohnsituation, so sperrig wie das Wort klingt, will man sofort in sein Schneckenhäuschen kriechen, wenn man denn eines hat…
Einen alten Klassenkameraden von mir verschlug es auch in die Hauptstadt. Wie so viele Brandenburger wollte auch Georg der Tristesse des märkischen Sandes entkommen. Wir begrüßen uns am Bahnhof Ostkreuz, der sich in den letzten sechs Jahren ebenso rasant verändert hat, wie das daneben liegende Kiez am Annemirl-Bauer-Platz. Nur der schwarze Wasserturm erinnert mich an dieses einst rostige Drehkreuz mit der maroden Fußgängerbrücke. Damals sah das Ostkreuz eher wie ein behelfsmäßiger Güterbahnhof aus. Es wurde gebaut, aber das übersah man. Friedrichshain war schon damals langsam „im Kommen“, aber halt nur langsam.
Inzwischen fühlen wir zwei uns hier überlebt. Georg soll reden und ich will das aufschreiben. Das ist ein bisschen so, als säßen wir beide in einer kleinen Pappschachtel, und ich würde fragen: Wie fühlen sie sich hier, so bedrängt, mit dem Rücken zur Wand? So ein bisschen merkt man ihm den Frust schon an, und mir auch.
Wir laufen zur Boxhagener hoch. „Da hinten ist ein guter Japaner.“, meint Georg, zeigt hinter sich. Ehe ich mich umdrehe, empfiehlt er schon das nächste Lokal. Das Straßenbräu mache gutes Bier, er zeigt nach links, und schaut in ein Lederwarengeschäft. „Wie lange sich Das halten wird?“, fragt sich Georg, und schaut auf die vielen Ledertaschen. Es riecht kurz nach Leder, und wir biegen ab in die Boxhagener.
Wenn man will, kann man sich mit jeder Situation zufrieden geben. (Georg)
Georg hat gern hier gewohnt. Er ruft Klar!, wenn man ihn danach fragt. Klar, weil hier ist es schön! Wir setzen uns in den Haferkater. Porrige, Machalatte, und Kaffee werden auf einer kleinen Tafel angeboten. Die Wände sind weiß gestrichen, die Einrichtung eine Mischung aus IKEA und Manufactum, und die Musik stößt sommerliche Techno-Melodien auf die Straße. Der Haferkater kommt daher wie eine Frittenbude, wie man sie kennt, die nach Jahren auf dem Parkplatz vorm Supermarkt festgewachsen ist. Sie ist bloß ein bisschen teurer, und riecht nich so nach Friteusenfett.
Direkt gegenüber steht noch eine leere Schleckerfiliale, und dahinter: protzige Neubauten, Fassaden aus Glas, Stahl, weiß, so als wollten sie gegen die Umgebung strahlen. Das Gleich-in-Gleich lässt Georg ruhig werden. Wir sitzen an der Straße. „So was“, Georg zeigt auf die neuen Fassaden hinter der Schleckerfiliale, „so was macht die Stadt tot.“

Schleckerfiliale und Neubauten © by Niels
Georg ist jetzt Pendler. Da er so schnell keine neue Wohnung innerhalb Berlins findet, lohnt es für ihn eher rauszufahren, und in Brandenburg zu wohnen.
„Es ist schon verrückt“, meint er, „wie sich diese Stadt verändert hat“. Als er nach Berlin kam, zog er in eine WG am Annemirl-Bauer-Platz. Wenn man mit der S-Bahn Richtung Warschauer Straße unterwegs ist, erkennt man das Gebäude zur rechten Seite sofort: der beige Altbau ist das einzige Haus, was nicht neu hochgezogen wurde. Daneben stehen neue Wohnkomplexe, Luxuslofts, die zum Teil als Eigentumswohnungen für ca. 500.000 Euro verkauft werden. Der Wandel aber, sagt er, habe sich schleichend vollzogen.
Ihr ehemaliger Vermieter, der dieses Haus in den Neunzigerjahren für angeblich 30.000 Mark gekauft hätte, habe seine Meinung gegenüber den alten Mietverträgen auch geändert.
Erst seien in ihrem Haus bessere Türen eingebaut worden, damit die Obdachlosen ihre Notdurft nicht im Hauseingang vollrichten. Später kamen andere Sachen hinzu: Bewohner, die er nie gesehen habe, die ein- und ausgingen. Fremde gebe es natürlich überall, aber die Fluktuation sei übertrieben gewesen. Man hätte sich nicht mehr kennengelernt.
Wenn man will, kann man sich mit jeder Situation zufrieden geben. Aber niemand will in einer Stadt arbeiten und leben, die ihn bereits durch die hochmodernen oder neusanierten Fassaden zurückweist. Der abschätzige Blick eines anthrazitfarbenen Hauses kann schon bedrücken… Was für viele schön aussieht, gemeinhin schick ist, ist für Georg mit gemischten Gefühlen verbunden. Manche Bekannte von ihm haben zwar Zimmer beziehen können, in einem Szenekiez gelebt, aber dafür eine übertrieben teure Miete zahlen müssen.
Hier gibt es keine Cafés, keine Menschen, aber dafür ist es ruhig. (Georg)
Wir gehen weiter, die Lenbachstraße runter bis zur Carlotta-Bar. Die Kugel Zitroneneis schmeckt auch nach Zitrone. Wahlweise kann man sich braunen Zucker oder bunte Streusel auf die Kugel machen. Georg entscheidet sich für die bunten Streusel, bevor wir in die nächste Straße einbiegen. In der Sonntagstraße ist es dann auch mit den Geschäften vorbei. Große Fensterfronten gibt es auf der linken Seite zur Genüge. Hier gibt es keine Cafés, keine Menschen, aber dafür ist es ruhig. „Alles tot hier.“, sagt er.
Die Nächste biegen wir links ab, die Holteisstraße hoch in die Helmerdingstraße. Am Ende dieser Straße sehen wir schon die niedrigen Baracken ohne Fenster, die aussehen wie Lagerhallen. Da drinnen verbirgt sich das ROSIS. Der Klub hat Tradition, und wer auf Indie-Partys steht, kennt ihn. Im Innenhof gibt’s Curry-Wurst oder Pizza, ab und zu wird Electro-Funk zum Besten gegeben, und draußen kann man gut sitzen. Im Dezember ist Schluss damit. Dann wars das mit dem Zwei-Euro-Eintritt und dem letzten Spätibier vorm Eingang.

Helmerdingstraße © by Niels
Ein schwarzer Audi fährt rückwärts vom Hof. Kurz bevor er die Mauer streift, bremst der Fahrer abrupt ab. Georg steht auf der Straße. Nebenan hieven zwei Möbelpacker einen massiven Holztisch – sicherlich aus irgendeinem Showroom – auf einen Sprinter. Alle schauen auf das schwarze große Auto. Die Sonne knallt auf die Pflastersteine, jeder kneift die Augen zu. Auf der Revaler ist an diesem Nachmittag sonst nichts los.
Und dann stehen wir vor einer braunen Gitterwand, die Teil eines neuen Gebäudes ist, was nicht nur neu, sondern auch über alle Maßen grau ist… Direkt daneben steht das Haus in dem Georg gewohnt hat. An dieser Stelle treffen nicht nur zwei Häuser aufeinander, sondern auch zwei Welten. Links die Wand aus Stahl und grauen Beton, ein Massiv, das unberührbar ist, und rechts eine von Graffitis regelrecht gemauerte Wand.
Georg zupft im Hauseingang vorsichtig an einem Klingelschild. Er hofft darunter noch die Namen seiner alten WG zu finden. Wir können beide nichts erkennen, also gehen wir weiter bis zum Ostkreuz. Zum Schluss zeigt er mir die originale Chabeso-Brause. Die ist durchsichtig wie Wasser, und schmeckt ein wenig wie ein Milchshake. Eine reicht, zwei solle man davon nicht trinken – jedenfalls nicht hintereinander. Der süße hängt mir noch eine ganze Weile im Mund.
Manchmal, sag er, haben Menschen einfach von der anderen Straßenseite aus ihr Haus fotografiert. Seine ehemalige Haustür sei bereits ein beliebtes Motiv auf Instagram, was mit einem #thisisberlin! gerne kommentiert wird…

Georgs Haustür © by Niels
Leben im Wohnheim: „Die Möbel sind alt, besonders in der Küche“
von Anne
Unsere Autorin Anne wohnt in einem Studentenwohnheim. Ihre Mitbewohnerin Julia* hat sich dazu bereiterklärt ihr Rede und Antwort zu stehen. Wie es sich lebt, und was trotz der niedrigen Miete dennoch fehlt, hat sie uns in einem kurzen Interview erklärt.
Die Wohnsituation in Berlin stellt für die Mehrheit aller Student_innen eine große Herausforderung da. Wer auf der Suche nach einem Zimmer ist, wird sich üblicherweise zuerst an das StudentierendenWERK Berlin wenden.
Die steigende Anzahl an Studienanfänger_innen kann durch die wenigen freien Zimmer nur schwerlich gedeckt werden. Jana Judisch, Pressesprecherin beim studierendenWERK, sagt dazu:
Wir haben fast 4.000 Studierende auf der Bewerberliste und wissen aus Erfahrung, dass diese Zahl zum Start des Wintersemesters sogar steigen wird. Der Bedarf für weitere Wohnheimplätze ist also ganz eindeutig gegeben. (Jana Judisch, Pressesprecherin beim studierendenWERK)
Die Studierenden müssen daher häufig Alternativen in Betracht ziehen. Das studierendenWERK Berlin versucht auf die Wohnungsnot dadurch zu reagieren, indem sie den Bestand verdichtet, Neubauten neben den Wohnheimen errichtet, und Konzepte für die Umnutzung von beispielsweise Parkhäusern prüft. Dies seien aber, so Jana Judisch, häufig sehr komplexe Prozesse, deren Genehmigungen sehr langwiedrig sind, und manchmal wegen der hohen Kosten gar nicht umgesetzt werden können.
Die Studentin Julia hat ein Platz im Wohnheim Steglitz ergattet. Warum Sie dort auch weiterhin wohnen will, hat sie uns erzählt.
Anne: Was studierst Du?
Julia: Philosophie und Sozialwissenschaften im Bachelor.
Anne: Warum hast Du Dich für ein Wohnheim entschieden?
Julia: Vor allem ist es hier günstig, sonst ist es generell schwierig hier in Berlin ein Zimmer zu finden, und deshalb war dies für mich damals die einzige Möglichkeit.
Anne: Du hast in zwei Wohnheimen gewohnt. Gab es zwischen beiden Wohnheimen einen Unterschied?
Julia: Das erste Wohnheim war super. Es war einfach wie eine WG, eine geschlossene Wohnung, nicht so wie hier. Wir waren dort zu dritt und.. ja, das war wie eine eigene Wohnung. Normal mit Küche und Bad, es war sauber, neu und wirklich super… Aber die Leute waren nicht so freundlich, wie hier. Wir haben gar nicht miteinander geredet. Die Wohnung an sich war cool, aber die Leute nicht. Deswegen ist es an sich hier besser.
Anne: Warum hast du das Wohnheim gewechselt?
Julia: Ich dachte damals, dass ich an der FU studieren werde, und dann wäre es zu weit weg von Lichtenberg.
Anne: Was findest du gut an diesem Wohnheim?
Julia: Vor allem die Atmosphäre ist ziemlich gut, finde ich. Die Leute sind sehr freundlich und es gibt viele Erasmus-Studenten, was auch Nachteile hat, aber auch den Vorteil, dass Leute sehr freundlich und generell aufgeschlossen sind. Und die Lage ist nicht so schlimm, weil du brauchst fünf Minuten zur U-Bahn oder S-Bahn.
Anne: Und was findest Du nicht so gut an dem Wohnheim?
Julia: Die Möbel sind alt, besonders in der Küche. Also ich glaube, dass sollte schon gewechselt werden. Es ist schon an der Zeit (lacht)!
Anne: Wir haben einen neuen Tisch…
Julia: Ja, stimmt (lacht). Was ich nicht gut finde, war die Frage? Den Hausmeister und dass man keinen Einfluss darauf hat, mit wem man die Küche teilt.
Anne: Hast du jemals überlegt in eine WG zu wechseln?
Julia: Ja, aus den Gründen, die ich gerade genannt habe. Aber ich weiß, dass ich es nicht machen würde, weil es zu teuer wäre.
*der Name wurde geändert.
„Privatbesitz enteignen, bezahlbarer Wohnraum für alle“: Zwei engagierte Studierende blicken auf den Berliner Wohungsmarkt
von Nick
Vergrößern

leftreport.org
Die Zahl der Studierenden, die sich für eine andere Wohnpolitik einsetzten nimmt zu. Zwei davon sind Luisa und Christin. Sie berichten von ihren Erfahrungen und
Einblicken.
Immer mehr Bündnisse wehren sich in Berlin wehren sich gegen die steigenden Mieten und den sogenannten spekulativen Leerstand von Wohnungen und Häuser. Besonders Aufsehen erregte die Gruppe #besetzen die am diesjährigen Pfingstsonntagverschiedene Häuser und Wohnungen für mehrere Stunden besetzte, bis die Gebäude von der Polizei geräumt wurden. Auch studentische Gruppen haben sich organisiert, um auf die studentische Wohnungsnot als Teil des größeren Problems aufmerksam zu machen. Zu Beginn des Wintersemesters 17/18 haben die Berliner Asten den Senat dazu aufgefordert, Notunterkünfte für wohnungslose Student_innen einzurichten. Die Berliner Asten, die als LandesAstenKonferenz (LAK) einen Zusammenschluss bilden, haben später eine wohnpolitische Kampagne initiiert und zu der Demo „Widersetzten.Gemeinsam gegen Verdrängung und #Mietenwahnsinn“, die am 14. April 2018 aufgerufen.
Vergrößern

LAK Berlin
Luisa und Christin engagieren sich für die wohnpolitische Anliegen von Berliner Student_innen. Luisa schreibt gerade an ihrer Masterarbeit in Politikwissenschaft an FU und koordiniert die AG Wohnen der der LAK. Christin studiert Philosophie im Bachelor und arbeitet als Sozialreferentin beim Referent_innenrat (RefRat), der Asta der HU. Auch sie beide haben schon unangenehme Erfahrungen auf der Suche nach einer Wohnung in Berlin gemacht.
Seit die LAK ihre Kampagne gestartet hat, erhält sie Nachrichten von Studierenden, die von ihren Erlebnissen, Ausweichwohnorten und Miseren erzählen. Luisa führt einige Beispiele an.
Die Wohnkosten steigen für Student_innen rasant. Doch wie wirkt sich das auf das Studium aus? Kann man überhaupt noch richtig studieren? Luisas Analyse der Wohnsituation für Studierende, lässt einen daran zweifeln.
Beide insistieren aber darauf, das damit nur die Oberfläche des Problems angekratzt ist. Hauptproblem sei die kapitalorientierte Wohnpolitik des Berliner Senats, der seit Jahren der Gentrifizierung, spekulativem Leerstand und steigenden Mieten zusehe. Der private Bau von „Luxus-Apartments“ in Wohnheimen, die erst von Investoren verkauft und dann teuer an zahlungswillige Student_innen vermietet werden, sei das erschreckende Sinnbild dieses Prozesses.
Zum Abschluss haben die beiden ihre Forderungen an die Politik und ihren Aufruf an die Student_innen formuliert. Eines sei klar: Erst müsse jeder Studierende den Zusammenhang zwischen der eignen Situation und dem strukturellen Problem erkennen, damit eine größere Gruppe sich für eine andere Wohnpolitik engagiere.